Wer sich ein Ratgeberbuch kauft, erwartet viel Fachwissen vom Autor. Der Verfasser muss das Thema nicht zwangsläufig studiert haben, über das er schreibt. Wenn sich ein Bas Kast fleißig ein Jahr hinsetzt und unzählige Studien über Ernährung auswertet, trauen wir seinen Ergebnissen. Erstaunlich, da er weder Mediziner noch Ernährungswissenschaftler ist. Geht es um die Grenzerfahrung einer schweren Krankheit, erkennen wir sehr wohl, ob der Autor oder seine engsten Angehörigen davon betroffen waren. Wer der Krankheit Auge in Auge gegenübersteht, bekommt zwangsläufig eine neue Perspektive. Genau deshalb ist das Buch von Susanne Reinker so bemerkenswert. Die Autorin erkrankte 2007 an Krebs und ist heute eine sogenannte Krebs-Veteranin. Doch ihr Buch ist kein rührseliger Rückblick, in dem sie erklärt, wie sie nach der Krebserkrankung ihr Leben verändert hat.
Der gut strukturierte Ratgeber “Kopf hoch, Brust raus!” nimmt in 36 Kapiteln seine Leser an die Hand und begleitet sie durch die schwere Zeit. Aus ihren eigenen Erfahrungen gibt sie den „Krebsen“, aber auch deren Freunden und Verwandten wertvolle Empfehlungen. Dabei räumt sie radikal mit Stereotypen auf und redet Tacheles. Wundern Sie sich nicht, wenn Kapitel Überschriften tragen wie „Alles Psychokacke, oder was?“ oder „Nebenwirkungen: Willkommen in der Geisterbahn“.
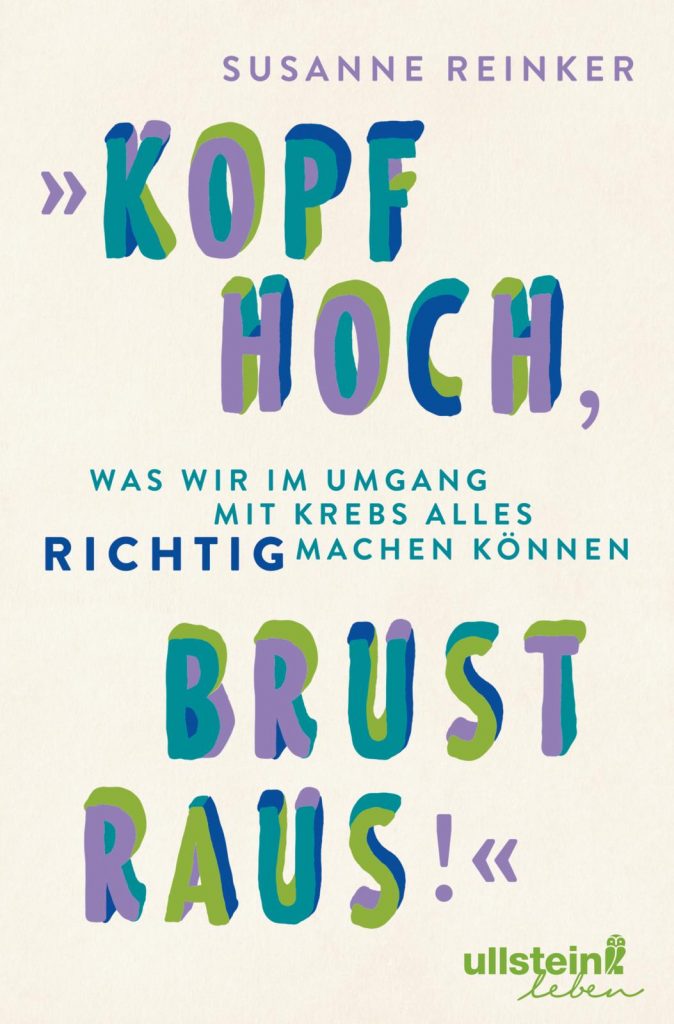
An wen richtet sich das Buch?
Wer hat überhaupt die Regel aufgestellt, dass ein Ratgeber ernst und würdig geschrieben sein muss? Warum dürfen wir nicht mehr humorvoll schreiben, nur weil es um ein ernstes Thema geht? Susanne Reinker setzt sich nonchalant über diese Regeln hinweg. Sie darf das, denn sie war von dem ernsten Thema selbst betroffen, von dem bösen K-Wort. Vor über zehn Jahren hätte sie sich über einen solchen Ratgeber gefreut. Einige Jahre nach ihrer Krebserkrankung schrieb sie ihn kurzerhand selbst. Sie nimmt in dem Buch kein Blatt vor den Mund und spricht zahlreiche vermeintliche Tabuthemen an. Wie ist das mit dem Sex, wenn mich der Partner nicht ohne Haare sehen soll? Oder: Warum gute Freunde eine Finanzspritze anbieten sollten, wenn sich der Patient die Zuzahlungen zur Krebstherapie kaum leisten kann.
Das Buch richtet sich nicht nur an Menschen, die Krebs haben. Die Autorin spricht forsch alle an, die mit den „Krebsen“ Kontakt haben. Es geht bei Familie und Freunden los und endet noch nicht bei Kollegen und Ärzten.
Was ist der Nachwirkungsblues bei Krebs?
Susanne Reinker schreibt in ihrem Buch über die Zeit der Behandlung und ganz offen über den Lebensabschnitt danach. Jene Zeit, auf die niemand vorbereitet ist. Ärzte, Familie und Freunde haben den klaren Fokus, den Angehörigen durch die schwere Zeit zu bringen. Ist die Behandlung durch und klingen die Nebenwirkungen ab, sollte möglichst schnell der Alltag wieder Einzug halten. Von den regelmäßigen Terminen zur Nachsorge abgesehen, verschwindet das K-Thema aus dem Leben. Zumindest in Deutschland, denn im französischen Gesundheitssystem ist es beispielsweise selbstverständlich, dass eine psychologische Betreuung zum Nachsorgeprogramm gehört. Wer in Deutschland als Folge der Krankheit unter Depressionen oder einer Angststörung leidet, kann bei den Krankenkassen eine Therapie beantragen, muss aber in der Regel mit monatelangen Wartezeiten rechnen. Ist der Nachwirkungsblues nach einigen Monaten verschwunden, wird vielleicht der gewünschte Therapieplatz frei.
Der Hauptzweck des Buches ist natürlich, den „Krebs-Neulingen“ einen Ratgeber an die Hand zu geben und Orientierung zu bieten. Doch damit endet es nicht. Ist das tiefe Tal durchschritten, die Behandlung beendet und der Alltag zurückgekehrt, haben die Patienten immer noch viele Fragen und Nöte. Darüber haben wir mit Susanne Reinker gesprochen und wollten wissen, was „nach dem Krebs“ kommt.
Frau Reinker, in Ihrem Buch sprechen Sie vom Nachwirkungsblues. Dieser betrifft den Patienten selbst, aber auch sein Umfeld. Sind die Angehörigen und Freude von der schweren Zeit erschöpft, zeigen sie vielleicht zu wenig Verständnis? Wie kann der Patient weiter Unterstützung einfordern, auch wenn er selbst mit den psychischen Nachwehen beschäftigt ist?
Susanne Reinker: Nach dem ewig langen Behandlungsparcours sind unsere Lieben genauso hoffnungsvoll wie wir selbst auch: Alles erst mal überstanden, hurra, wir können wieder durchstarten! Da baut sich bei allen, in unserem Umfeld und auch leider bei uns selbst, ein riesiger Erwartungsdruck auf. Das Riesenproblem daran: Nach der Therapie sind wir seelisch und körperlich noch lange nicht wieder so voll fit, wie alle sich das immer schön vorgestellt hatten. Statt Bäume ausreißen sind eher Erschöpfung und Depression angesagt. Das womöglich ein bis zwei Jahre lang und bisher ohne systematische Betreuung durch die Krankenkassen. Obendrein ist diese Phase für die meisten von uns eine richtig böse Überraschung. Denn bisher werden wir nicht systematisch darüber informiert, dass es sie überhaupt gibt, von präventiver Beratung und Behandlung ganz zu schweigen. Die Folge: Wir wollen aus dem Stand wieder zu 100 Prozent „funktionieren“ und überanstrengen uns, bis der Körper uns mit Grippe, Magenverstimmungen, Blasenentzündungen oder Panikattacken erst mal wieder außer Gefecht setzt.
Wenn wir wüssten, dass diese Gefahr besteht, wären wir wenigstens vorgewarnt und könnten versuchen, uns (mal wieder) selbst zu helfen. Und zwar nicht nur durch frühzeitige Bemühung um psychologische Betreuung und Ausprobieren diverser Entspannungstechniken. Sondern auch, indem wir unser Umfeld klipp und klar und immer wieder über den Nachwirkungsblues aufklären, Verständnis und Geduld erbitten oder schlicht einfordern, wenn der Druck zu groß wird. Und, besonders wichtig, diese Phase als gegeben hinnehmen, anstatt uns mit Selbstvorwürfen zu traktieren.

Frau Reinker, eine Krebserkrankung kann dazu führen, dass die Betroffenen Dinge klarer sehen. Sie wollen sich in ihrem Leben auf das Wesentliche reduzieren und streben möglicherweise größere Veränderungen an. Raten Sie, diese Veränderungen sofort anzugehen und sich beispielsweise von „toxischen“ Beziehungen zu befreien? Oder ist erst einmal Vorsicht geboten, um in der emotionalen Ausnahmesituation nicht gleich Brücken einzureißen, die sich nicht ohne Weiteres wieder aufbauen lassen?
Susanne Reinker: Das stimmt, wir sehen viele Dinge klarer. Nicht immer völlig überraschend, denn einiges haben wir vorher schon gewusst und nur verdrängt. Von nicht wirklich gesunden Essgewohnheiten über nagende Unzufriedenheit im Job bis hin zum Stellungskrieg in der Beziehung. Das sind alles im wahrsten Sinne des Wortes zukunftsweisende Erkenntnisse – aber wir brauchen viel Energie, innere Stabilität und Geduld, um sie dauerhaft in die Tat umzusetzen. Leider allesamt Voraussetzungen, die wir während des Behandlungsparcours und auch noch ziemlich lange danach nur ansatzweise oder gar nicht erfüllen. Und das ist kein Grund zu Scham oder Selbstvorwürfen, sondern völlig normal. Eine Krebstherapie ist ja keine Kreuzfahrt.
Einige von uns wollen trotzdem vor lauter Panik ihr Leben von jetzt auf gleich radikal ändern. Das ist verständlich. Aber es ist einfach nicht zu stemmen. Es kostet zu viel Kraft, die wir brauchen, um gesundheitlich aus dem Gröbsten rauszukommen. In der Lebenslage sind wir mit der Krebs-Baustelle schon bedient, da brauchen wir nicht auch noch eine Ernährungs- oder Beziehungsbaustelle. Die können (und sollten) wir erst angehen, wenn wir uns wieder einigermaßen stabil fühlen.
Frau Reinker, wie ist es aus Ihrer Sicht um die Nachsorge im deutschen Gesundheitssystem bestellt? Reichen die medizinischen und therapeutischen Angebote, um nachhaltig wieder auf die Beine zu kommen? Gibt es Leistungen, die Sie als Patient gezielt einfordern sollten oder die Sie besser gleich privat finanzieren?
Susanne Reinker: Die medizinische Nachsorge ist nach meiner Erfahrung engmaschig und gut. Im psycho-somatischen Bereich schaut es allerdings anders aus. Die standardmäßige Reha gibt zwar wichtige Impulse, aber die paar Wochen reichen nicht aus, um die klassischen Krebsfolgen Depression, Panik und Todesangst einzudämmen. Vor allem nicht bei Menschen, die nach der Reha in einen problembelasteten Alltag zurückkehren müssen und zu arm sind, um sich auf eigene Kosten Hilfe zu suchen. Oder zu erschöpft oder zu wenig informiert, um bei den Krankenkassen psychosomatische Behandlung zu beantragen.
Was bisher fehlt, ist die Aufnahme solcher Therapien in den Katalog routinemäßiger Kassenleistungen für Krebspatienten. Warum wird unsere psychische Verfassung nach dem Behandlungsparcours nicht über mehrere Jahre hinweg genauso engmaschig untersucht wie unsere körperliche Verfassung? Warum dürfen, oder bessergesagt: müssen Hausärzte und betreuende Onkologen nicht standardmäßig Hilfsmaßnahmen für die Psyche verschreiben, sobald sie Anzeichen für eine Schieflage erkennen? Und damit meine ich nicht nur sprachbasierte Therapien, sondern auch niedrigschwellige Angebote wie Gestalt- oder Kunsttherapie, progressive Muskelentspannung, Yoga und dergleichen für alle, die eine Gesprächstherapie nicht wahrnehmen können oder wollen, aus welchen Gründen auch immer. Mir persönlich ist unbegreiflich, wieso die Kassen „aus Kostengründen“ auf eine routinemäßige psychosomatische Nachsorge verzichten, obwohl eventuelle Folgeerkrankungen wesentlich teurer zu Buche schlagen.

Frau Reinker, Sie sprechen in Ihrem Buch offen die finanzielle Belastung durch die Krankheit an. Welche Möglichkeiten der Unterstützung sehen Sie, wenn es mit einer kleinen Rente eng wird oder der Mensch weder Freunde noch Familie um Hilfe bitten möchte?
Susanne Reinker: Die finanziellen Folgen dieser Krankheit sind eine bittere Pille. Anders als in Frankreich, wo Krebskranke von Zuzahlungen befreit sind, muss unsereins sogar für jede einzelne Chemo zuzahlen, von den Zuzahlungen für alle anderen Medikamente ganz zu schweigen. Kommt dazu noch ein krankheitsbedingter Einnahmenausfall, wie das bei Selbstständigen schnell passiert, rutscht man tief in die roten Zahlen. Die Folge sind zusätzlich zur Krebspanik massive Existenzängste, die diese Lebenslage noch schlimmer machen. Insbesondere betroffen sind Geringverdiener, Langzeitarbeitslose, alleinerziehende Mütter und Rentner*innen am Existenzminimum. Deren Umfeld braucht eigentlich nicht viel Fantasie, um sich die wachsenden Finanznöte vorzustellen – aber über Geld redet man nicht bekanntlich nicht. Die Betroffenen schweigen aus Scham, Familie und Freunde aus Taktgefühl, Ergebnis: keins.
Und genau das muss sich dringend ändern. Den Betroffenen kann man es nicht verdenken, dass sie weder Mut noch Energie genug haben, offen über ihre Lage zu sprechen. Also müssen die glücklichen Gesunden bitteschön die Initiative ergreifen! Helfen kann ECHT jeder. Nicht unbedingt mit fetten Finanzspritzen, wer hat daheim schon einen Geldspeicher. Aber immer mal wieder ein kleiner Betrag in ein diskret aufgestelltes Krebssparschwein? Ein kleinerer oder auch größerer zinsloser Kredit, ein Krebs-Rabatt, ein Zahlungsaufschub? Unabhängig von Münzen und Scheinen gibt es unendlich viele andere Möglichkeiten: Sachspenden von Obst und Gemüse bis Geschenkgutscheinen aller Art bei Online-Shopping-Diensten, Zeitspenden von Babysitting bis Fahrdienst, Service-Spenden vom „Ausleihen“ der eigenen Putzkraft bis zum Erholungswochenende in der Ferienwohnung eines Freundes, den man schlicht um diesen Gefallen bittet. Mit ein bisschen Empathie kommt man auf Hunderte Ideen. Jede einzelne und erst recht alle zusammen mit Sicherheit eine Riesenhilfe.
Liebe Frau Reinker, wir danken Ihnen sehr herzlich für das Gespräch und dass Sie den längst überfälligen Ratgeber zum Thema Krebs geschrieben haben.









